Filmtagebuch einer 13-Jährigen #7
Von Silvia Szymanski // 8. April 2013 // Tagged: Bulgarien, Deutsches Kino, featured, Heimat, Italo-Western, Seltsame Frauen, Sexploitation, Vergewaltigung // 2 Kommentare
 Warning: DOMDocument::loadXML(): Opening and ending tag mismatch: hr line 5 and body in Entity, line: 6 in /var/www/vhosts/f021.futris02.de/httpdocs/hardsensations/wp-content/plugins/wordpress-amazon-associate/APaPi/AmazonProduct/Result.php on line 149
Warning: DOMDocument::loadXML(): Opening and ending tag mismatch: body line 3 and html in Entity, line: 7 in /var/www/vhosts/f021.futris02.de/httpdocs/hardsensations/wp-content/plugins/wordpress-amazon-associate/APaPi/AmazonProduct/Result.php on line 149
Warning: DOMDocument::loadXML(): Premature end of data in tag html line 1 in Entity, line: 8 in /var/www/vhosts/f021.futris02.de/httpdocs/hardsensations/wp-content/plugins/wordpress-amazon-associate/APaPi/AmazonProduct/Result.php on line 149
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/vhosts/f021.futris02.de/httpdocs/hardsensations/wp-content/plugins/wordpress-amazon-associate/APaPi/AmazonProduct/Result.php on line 160
Warning: DOMDocument::loadXML(): Opening and ending tag mismatch: hr line 5 and body in Entity, line: 6 in /var/www/vhosts/f021.futris02.de/httpdocs/hardsensations/wp-content/plugins/wordpress-amazon-associate/APaPi/AmazonProduct/Result.php on line 149
Warning: DOMDocument::loadXML(): Opening and ending tag mismatch: body line 3 and html in Entity, line: 7 in /var/www/vhosts/f021.futris02.de/httpdocs/hardsensations/wp-content/plugins/wordpress-amazon-associate/APaPi/AmazonProduct/Result.php on line 149
Warning: DOMDocument::loadXML(): Premature end of data in tag html line 1 in Entity, line: 8 in /var/www/vhosts/f021.futris02.de/httpdocs/hardsensations/wp-content/plugins/wordpress-amazon-associate/APaPi/AmazonProduct/Result.php on line 149
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/vhosts/f021.futris02.de/httpdocs/hardsensations/wp-content/plugins/wordpress-amazon-associate/APaPi/AmazonProduct/Result.php on line 160
15. bis 17. März 2013: Rund um zwei Abende im Kölner Filmclub 813 herum haben wir – Filmfreunde von überall, besonders aber die mitorganisierenden „Eskalierenden Träume“ – Männern und Frauen bei Liebe, Sex und großen Schwierigkeiten zugeschaut. In Bulgarien, Südamerika, Wien, Paris, London und den Dolomiten. Aus der Hard Sensations Mannschaft waren Alex Klotz (am letzten Abend), Michael Schleeh (am ersten und am letzten Abend) und ich dabei.
Köln, 15.3. 2013 „Heimlichkeiten“, Deutschland / Bulgarien 1968
Regie: Wolfgang Staudte, Kamera: Wolf Wirth, Schnitt: Rosemarie Kubera, Musik: Miltscho Lewiew
 Früher hab ich die kernig-vitalen, betont maskulinen Mainstreammänner der 60er/70er Jahre mit Beklemmung und Unbehagen angesehen. Sie waren so erwachsen, so athletisch-knochig-muskulös, wie nach klassischem Sport und körperlicher Arbeit. Als Models in Reklamen oder Versandhauskatalogen standen sie in Unterhosen zusammen, wiesen einander auf eine Stelle in einem Buch hin, rauchten Pfeife, runzelten ernst die Stirn oder lachten plakativ. Live sah man sie – wenn nicht als kinderliebe, jugoslawische Dachdecker beim Bau seines Elternhauses – am ehesten in Freibädern. Oder am Strand.
Früher hab ich die kernig-vitalen, betont maskulinen Mainstreammänner der 60er/70er Jahre mit Beklemmung und Unbehagen angesehen. Sie waren so erwachsen, so athletisch-knochig-muskulös, wie nach klassischem Sport und körperlicher Arbeit. Als Models in Reklamen oder Versandhauskatalogen standen sie in Unterhosen zusammen, wiesen einander auf eine Stelle in einem Buch hin, rauchten Pfeife, runzelten ernst die Stirn oder lachten plakativ. Live sah man sie – wenn nicht als kinderliebe, jugoslawische Dachdecker beim Bau seines Elternhauses – am ehesten in Freibädern. Oder am Strand.
Colonel Damyanov (Apostol Karamitev, s. o.), der beiläufig-spielerische Ermittler in einem Mordfall, um den die Filmszenen kreisen wie ein Mobile, ist einer dieser körperlichen, lässigen, markanten, dunkel behaarten Männer, genau wie Karl-Michael Vogler (s. kleines Foto oben), der den Hauptverdächtigen spielt. Schon DEEP END brachte Vogler mit Wasser in Verbindung. Auch in HEIMLICHKEITEN laufen Wasserperlen an ihm herunter, so dass sich die Haare auf seinen festen, massig-muskulösen Beinen wie Algen strecken. Die eng stehenden Augen unter den breiten, dunklen Augenbrauen haben etwas Greifvogelartiges. Die beiden Männer beobachten einander unaufgeregt, ausweichend, nachdenklich. Obwohl sie so entwickelt aussehen, sind sie keine Machos, sondern… irgendwas. Alle sind hier nur irgendwas – Dinge am Meer, deren Verschiedenartigkeit ausgeglichen wird durch die überwältigenden Gemeinsamkeiten des gemeinsamen Halbnacktseins am Strand und durch die Zerstreuungen, denen alle nachgehen. Dieses Flair an der Goldküste hat etwas Sozialistisches; in den 60er Jahren war der Bulgarienurlaub erschwinglich geworden für Leute auch der nicht gehobenen Schichten.
Es ist eine fremde, angenehme Atmosphäre. Man glaubt, den Schweiß zu riechen, wie von Bauarbeitern im Sommer, und überall herrscht dieses prickelnd entwurzelte und offene Gefühl „Ausland“. Da sind der Holländer, die Schwedin, die Bulgaren, die Ostdeutschen und die Westdeutschen. Andere Währung, andere Gesetze, und am Zeitungsstand gibt es internationale Zeitungen. Einmal kauft Vogler gedankenlos eine bulgarische; er hat ganz vergessen, dass er die Sprache nicht versteht. Auch seine illegitime und illegale Freundin aus Magdeburg versteht sie nicht, obwohl sie russisch kann.
Die Urlauber verdächtigen einander vage des Verbechens, aber das Meer rauscht und flimmert die Gedanken weg, dann rollt der Zirkusbär seinen schweren Körper über die Promenade, wir schauen ihm lange mit den anderen zu, es gibt eine wild-archaische Volkskunst-Maskerade, ekstatisch brüstewackelnden Bauchtanzlimbo, leichten, kultivierten Jazz am Abend auf der Restaurantterrasse. Die Touristen machen Liebe in ihren Hotelzimmer, Dialogfetzchen wehen herüber von den Akteuren, während die Kamera aufs glitzernde Meer schaut oder auf einem Parkplatz Autos und Reisebusse betrachtet.
Auch Vogler liegt mit seiner Freundin in einer langen, versonnen verschraubten Knutschszene so entspannt am Strand als wäre keine Kamera dabei. Die Kamera versteckt sich ja auch vor den Schauspielern und der Handlung. Es ist, als hätte man sie einem Kind oder einem sehr ablenkbarem Voyeur umgebunden. Sie ist viel mehr bei sich als bei dem, was man von ihr erwarten würde. Schweift ab, geht spazieren, hört auf die Geräusche, schaut ganz lange das bunte Treiben am Strand an, die vielen Urlauber und was sie tragen, die schöne Bademode. Die Szenen sind so mutig und geschickt in Fetzchen geschnitten und montiert, dass sie zu der luftigen Filmmusik, einem Herbie-Mann-ähnlichen Jazz passen.
Im Film wird diese Musik der kleinen Combo zugeschrieben, die abends in der Bettenburg auftritt. In ihr musiziert ein junger Holländer, der sich dann verabschiedet, um in der Handlung seine kleine Rolle zu spielen. So überlappen sich die Szenen, natürlich und verspielt, wie transparente Farbfolien, „Jazz on a summer’s day“. Einmal liefern Vogler und seine Freundin sich auf ihrem Hotelzimmer flirtend eine Schlacht, mit Kleidern, die sie aufeinander werfen; sie toben durch die Luft wie Blätter. Auch draußen kommt ein starker Wind auf, die Zeitungen fliegen davon, die Sonnenschirme flattern, Leute laufen durcheinander, Gedanken lösen sich auf. So ist der Geist des Films. Sehr schön.
Die Freunde schwärmten später von den Frauen in dem Film, besonders von der hübschen Kollegin des Ermittlers. Am Anfang müssen sie mir auch aufgefallen sein, immerhin habe ich von einer ein Foto gemacht.
 Leider habe ich aber verschämt meine Regung unterdrückt, den halbnackten Vogler und den Colonel (s. links) zu fotografieren; nun tut es mir Leid, dass sie auf meinen Bildern fast nicht drauf sind.
Leider habe ich aber verschämt meine Regung unterdrückt, den halbnackten Vogler und den Colonel (s. links) zu fotografieren; nun tut es mir Leid, dass sie auf meinen Bildern fast nicht drauf sind.
Christoph hat übrigens hier auf HEIMLICHKEITEN hingewiesen.
Ich übernachtete in Köln auch in einem Hotel, dem „Chelsea“. In meinem Trakt feierten Leute auf ihren Zimmern Partys; ich roch wohlig den Zigarettenqualm, wenn ich zur Flurtoilette ging, und fühlte mich geborgen.
16. 3. 2013 Ein Kino in einem samstagmittaglichen, sehr gewohnten Einkaufsviertel. Von hier aus stiegen wir tief hinab in eine traurig überschattete Landschaft.
Haut für Haut. Le gout de la violence (1961) Regie: Robert Hossein.
Durch ein karges, wüstes Halbdunkel ziehen drei Desperados mit einer schönen Frau. Das Bild wird ab und zu durchtrennt von Aufstellungen und Prozessionen (Revolutionäre, Soldaten, Frauen mit Kerzen auf dem Weg zur Kirche, feindliche, am Horizont aufgereihte Linien.) Es herrscht eine verzweifelte, von Entsetzen gebannte Ruhe. Alles ist starr, wie die stacheligen Körper der Kakteeen – in Folge zu vieler Verluste, erzwungener Reduktion und Wehrhaftigkeit. Das Maisfeld, in dem sich die Revolutionäre verteilen, raschelt trocken; die Männer darin sehen aus wie Baumwollsamen, in ihren Anzügen aus ungefärbtem Nesselstoff. Dann beginnt das Feld, zu knistern, widerwillig weichen sie dem Feuer.
Die Frau (Giovanna Ralli) hält sich schweigend abseits, aber das verstärkt noch ihre Präsenz; sie ist das Zentrum dieses Films, zu dem man immer wieder hin schauen muss. Ihr Gesicht ist so beunruhigend ruhig, mondhaft schimmernd wie das von Ava Gardner, Claudia Cardinale oder Daliah Lavi in IL DEMONIO. Eine versteinerte, singuläre Schönheit, sehr ernst, gesammelt, unbewegt und glühend, eine menschliche Blume, deren Füße festgewachsen sind. „Das ist keine Frau mehr. Das ist Dynamit“, sagt Mario Adorf, ein pragmatisch gieriger, bodenhaftender Geist, jenseits von Idealen und Moral. Er stirbt als zweiter. (Der erste Tote ist klassischerweise der Weiche und Sensible -„Ich bin anders als die beiden“.) Übrig bleibt der komplexeste, Perez (Robert Hossein). Ein harter, in sich gekehrter Mann mit einem noch nicht zu Ende erschütterten Glauben an den großen Sinn des mörderischen Kampfes um revolutionäre Ideale. Die beiden verlieben sich. Ein wenig; es ist nicht mehr viel möglich. Alles, wohin sie kommen, ist zerstört, absurd und surreal. Die regennasse Gasse der besiegten, aufgehängten Revolutionäre. Das abgebrannte Elternhaus. Der an einem einsamen Gerüst gefolterte Typ am Strand. Das Meer, das sich in sie blendet wie aufwallende Gefühle.
Die Kamera konzentriert sich, traurig, nachdenklich, indem sie auf etwas zoomt. Es ist ihr auch egal, was wir darüber denken. Der Film mag auch nicht aufhören. Nach der Szene in dem Ausschnitt unten geht es weiter, bzw. hört es weiter auf. Es kommen immer weitere Enden, bis nichts mehr als Asche übrig bleibt. Beide reiten fort, jeder in eine andere Richtung.
Ich wollte aus dem Film nicht mehr zurück nach oben in den Samstagnachmittag.
Dieser Ausschnitt gibt es sehr gut wieder. Der ganze Film ist so.
Ein Kino ganz für uns allein, spät abends, belästigt von einem aufdringlichen, bedürftigen Schlaf, der uns von zwei sexuellen Filmen wegnötigen wollte:
Das Mädchen mit dem Mini (Österreich 1964, Regie: Paul Milan)
 Fritz Frons, mit dessen PERFEKT IN ALLEN STELLUNGEN ich mich sehr wohl fühlte, sieht man hier als altväterlicher Grandseigneur und generösen Westentaschen-Bonvivant in einem mild sonnig-seichten, pieselig-dürftigen Wien der frühen 60er Jahre, nahe bei einem ungeahnt kleinen „Riesen“-Rad. Seine viel jüngere Freundin kauft sich einen Oben-Ohne-Bikini, über den bald die ganze Stadt spricht. In ihrer Wohnung mag sie ihn gleich gar nicht mehr ausziehen.
Fritz Frons, mit dessen PERFEKT IN ALLEN STELLUNGEN ich mich sehr wohl fühlte, sieht man hier als altväterlicher Grandseigneur und generösen Westentaschen-Bonvivant in einem mild sonnig-seichten, pieselig-dürftigen Wien der frühen 60er Jahre, nahe bei einem ungeahnt kleinen „Riesen“-Rad. Seine viel jüngere Freundin kauft sich einen Oben-Ohne-Bikini, über den bald die ganze Stadt spricht. In ihrer Wohnung mag sie ihn gleich gar nicht mehr ausziehen.
Die Wohnung hat eine Dachterrasse, wo sie oft planschend und plaudernd sitzen, und das Ganze hat den Charme eines privaten, stummen Amateurfilms – es reichte nicht für einen Originalton; stattdessen hören wir die Stimme eines wohlgefälligen Ich-Erzählers, belustigend reich an geschraubten Formulierungen. Ich habe in letzter Zeit mehrere naive „Nudistenfilme“ gesehen, sie haben immer viel harmlose Nacktheit und die nichtigsten Handlungen der Welt; Doris Wishmans NACKT IM SOMMERWIND gehört dazu, MÄDCHEN IN DER SAUNA und TANJA, DIE NACKTE VON DER TEUFELSINSEL. Ich kann noch nicht analysieren, warum ich Wishman deutlich weniger mochte als die letzten beiden. DAS MÄDCHEN MIT DEM MINI mochte ich. Er hat feine, gedeckte, bunte Farben. Das Mädchen mit dem Minibikini wird von ihrem Liebhaber kopfschüttelnd-spöttisch bestaunt; sie pflegen ihre kleine, abgeschabte Behaglichkeit zu zweit vor dem ausgeschalteten Fernseher, beim Cognac aus Schwenkern und dem Licht einer alten Tischkerze, von der die Glasur abblättert. Als sie Besuch bekommen, stürmen die durchweg jungen Frauen in die Heimsauna; ihre älteren Herren müssen draußen bleiben und trösten sich mit einer Runde Skat. Alles spielt sich nur zwischen diesen wenigen Männern und Frauen ab, sie haben niemanden sonst und müssen notgedrungen etwas mit einander anfangen, in dieser Stadt, klein wie ein Vorgärtchen, ein Schuhkarton oder ein Grab.
Dann wurde mir kurz verwirrend übel. Mein Magen war verdutzt, dass ich ihm an diesem langen Tag so ungewohnte Sachen gefüttert und dann ein kaltes Kölsch darauf gekippt hatte. WC-Schüsseln sind lieb. Ich war dieser sehr dankbar.
Vergewaltigt/ Avortement clandestin!, Pierre Chevalier, Erwin C.Dietrich, 1976, Frankreich/Belgien/Schweiz.
 Ich wurde heftig von Müdigkeit geplagt, aber ich habe ihn als seltsam scharfen Film im Kopf. Seine sex-ausbeutende Tristesse und sein naiv umgesetztes, sozialkritisches Anliegen erinnerten mich an Jürgen Enz’ AUS DEM TAGEBUCH EINER SIEBZEHNJÄHRIGEN, aber er war sexuell deutlicher, treffender und kruder. Festgehalten hätte ich gern den Blick der Mutter durch die trübe Scheibe eines Autobusses auf die Straßen Londons, wo sie verzweifelt einen Abtreibungsarzt für ihre vergewaltigte Tochter sucht. Währenddessen versucht das Mädchen, das nötige Geld auf einer Party aufzutreiben, wohin sie ihre Freundin gelockt hat – da sei ein reicher Mann, der ihr helfen könne. Aber natürlich will der dafür Sex. Auf der Party erzählen zwei Männer einander ihre Erlebnisse als Vergewaltiger, während unten eine Frau kauert und ihnen beiden einen bläst. Der eine (Eric Falk), ein fleischiger Typ mit einem brutalen, hier auf Normalo frisierten Kopf (viele schlimme Normalos sind in diesem Film; das macht ihn extra-hart und interessant) erzählt, wie er ein Mädchen vergewaltigt hat, das sich in einem Keller versteckte, er nahm eine Axt und fiel über sie her. Doch dann gefiel es ihr, von da an wollte sie es jeden Tag drei Mal. Ein Metzger kommt auch vor; als von der Abtreibung die Rede ist, zerhackt er auf seiner Ladentheke ein Stück blutiges Fleisch oder Leber. Der Film, den wir gesehen haben, besteht überwiegend aus dem gleichnamigen belgisch/französischen Spielfilm von 1973, angereichtert durch beinah-pornographische Sexszenen von Erwin C. Dietrich. Es war ziemlich dampfend. Sehr schade, dass ich so müde war. Den Film würde ich gern wieder sehen. In einem Keller.
Ich wurde heftig von Müdigkeit geplagt, aber ich habe ihn als seltsam scharfen Film im Kopf. Seine sex-ausbeutende Tristesse und sein naiv umgesetztes, sozialkritisches Anliegen erinnerten mich an Jürgen Enz’ AUS DEM TAGEBUCH EINER SIEBZEHNJÄHRIGEN, aber er war sexuell deutlicher, treffender und kruder. Festgehalten hätte ich gern den Blick der Mutter durch die trübe Scheibe eines Autobusses auf die Straßen Londons, wo sie verzweifelt einen Abtreibungsarzt für ihre vergewaltigte Tochter sucht. Währenddessen versucht das Mädchen, das nötige Geld auf einer Party aufzutreiben, wohin sie ihre Freundin gelockt hat – da sei ein reicher Mann, der ihr helfen könne. Aber natürlich will der dafür Sex. Auf der Party erzählen zwei Männer einander ihre Erlebnisse als Vergewaltiger, während unten eine Frau kauert und ihnen beiden einen bläst. Der eine (Eric Falk), ein fleischiger Typ mit einem brutalen, hier auf Normalo frisierten Kopf (viele schlimme Normalos sind in diesem Film; das macht ihn extra-hart und interessant) erzählt, wie er ein Mädchen vergewaltigt hat, das sich in einem Keller versteckte, er nahm eine Axt und fiel über sie her. Doch dann gefiel es ihr, von da an wollte sie es jeden Tag drei Mal. Ein Metzger kommt auch vor; als von der Abtreibung die Rede ist, zerhackt er auf seiner Ladentheke ein Stück blutiges Fleisch oder Leber. Der Film, den wir gesehen haben, besteht überwiegend aus dem gleichnamigen belgisch/französischen Spielfilm von 1973, angereichtert durch beinah-pornographische Sexszenen von Erwin C. Dietrich. Es war ziemlich dampfend. Sehr schade, dass ich so müde war. Den Film würde ich gern wieder sehen. In einem Keller.
Der Schein der Belanglosigkeit im Ausschnitt oben täuscht. Das Mädchen erzählt ihrem Freund gerade, dass sie vergewaltigt wurde und nun ein Kind erwartet. Selbst wenn man nicht französisch kann: Die anderen wiesen mich zu Recht darauf hin, wie selbst der Kaffeelöffel spricht.

Eric Falk aus VERGEWALTIGT spielt auch in MAD FOXES, einem Film, den ich, obwohl dem Vernehm nach nur eine „richtige“ Vergewaltigung kurz drin vorkommt, länger schon mit Maria Wildeisen für unsere Reihe über Vergewaltigung im Film sehen will. Dieser Screenshot aus MAD FOXES lässt ahnen, warum.

„Vergewaltigt/ Avortement clandestin!“ ist auch einmal als Fotoroman in einer Illustrierten (der französischen „Bravo“?) erschienen.
Am nächsten Abend ging es in die Berge. Das war lustig. Und sehr strahlend.
17.3.2013, Filmclub 813: Nackt wie Gott sie schuf, Deutschland/Österreich/Italien 1958, Regie: Hans Schott-Schöbinger. Nach einem Roman von Johannes Mario Simmel.
 Ein Kloster in den Dolomiten, weit oberhalb der Baumgrenze; buschlos reflektiert der nackte Fels die Höhensonne. Nur vor der alten Goldmine blüht wie durch ein Wunder ein weißer Rosenstrauch. Wenn man eine Blüte davon irgendwo anders findet, stirbt ein Mönch. Das erschreckt vor allem die Mönche.
Ein Kloster in den Dolomiten, weit oberhalb der Baumgrenze; buschlos reflektiert der nackte Fels die Höhensonne. Nur vor der alten Goldmine blüht wie durch ein Wunder ein weißer Rosenstrauch. Wenn man eine Blüte davon irgendwo anders findet, stirbt ein Mönch. Das erschreckt vor allem die Mönche.
Sie sind ultra-urig, wie auf manchen Camembertschachteln. Und sie sind sehr, sehr religiös. Der Hauptmönch dieses Films (Carl Wery) ist außerdem ein wulstiges, cholerisches, grundgütiges Urgestein.
Deutlich unterhalb des Klosters befindet sich das gesetzlose Lager der Arbeiter, die, halbnackt beim Bau einer Straße, sich selbst und ihren Trieben überlassen sind. Diese Malocher haben aus dem Krieg gelernt, sich von Vorgesetzten und Autoritäten incl. Mönchen nichts mehr sagen lassen. Die meisten wirken authentisch abgehalftert und verdrossen unjung. Einer kratzt sich unablässig seinen nackten Arm, während sein Vorgesetzter zu ihm spricht – eine mir wohlbekannte Geste des Eigensinns und Unwillens, die ich bei Arbeitern früher oft im Umgang mit der Obrigkeit gesehen, aber vergessen hatte. Die Jüngeren, wie Jan Hendriks, werfen sich herausfordernd in Pose. Sie sind sauer auf die Mönche, die ihnen willkürlich die Wasserzufuhr blockieren; man kennt das auch aus manchen Western. Dann kann der italienische Bauarbeiter seine Bambini nicht waschen, wenn ihn seine kinderreiche Familie besuchen kommt. Und Ellen Schwiers, die Wirtin der Spelunke, kann den Männern nicht mehr ihren Schnaps verdünnen.
Am Zahltag kommt ein Bus voll toller Frauen hoch zu ihnen – Ehefrauen mit Kindern, Freundinnen und Freudenmädcheen. Die Kamera richtet sich als erstes auf ihre koketten Schuhe, als sie den Bus verlassen. Bald sind die Frauen überall. Die Landschaft ist obszön geschmückt mit ihnen wie im Traum. Sie lagern auf den großen Steinen in der Sonne, lassen sich, schreiend vor Lachen, mit dem dick schwellenden Wasserschlauch nass spritzen, so dass die Sachen prachtvoll an den Leibern kleben, promenieren carmenhaft im Dunstkreis der brünstigen, feixenden, schmierige Bemerkungen loslassenden Männer und tanzen abends Samba auf dem Wirtshaustisch. Sie heben die Röcke, zeigen ihre Strapse und strippen bis auf die stramme Miederware. Die Straßenarbeiter schreckt das nicht. Sie wissen, dass die überaus geformten Brüste der 50er Jahre in solcher Häufigkeit und Ausprägung nur durch solide Stützen möglich waren.
Die strahlendste der Frauen ist die ultraschöne, tugendhafte Gina (Marisa Allasio – die mit dem Dekolletee auf dem kleinen Bild am Anfang dieses Textes). Sie hat eine Traumfigur, einen gewaltigen Superbusen und tolle Kleider – besonders ihr Etuikleid aus schwerem, grausilbernem Stoff bildet einen aufreizend seriösen Gegensatz zu ihren Brüsten voller Versprechen. Gina ist wie die schneebedeckten Dolomitengipfel. Das Herz geht einem auf. Man will hin. Doch dann ist das viel ferner und viel schwerer als man dachte.
Carl Wery, Ginas Onkel, hat sie einst als Waisenkind ins Kloster geholt. Dorthin nun flieht sie vor dem negativen Einfluss ihres hübschen Verlobten Joschi. Denn Joschi schmuggelt. Wenn auch nur, damit sie endlich heiraten, ein Haus bauen und ohne Rücksicht auf die Nachbarn laut werden können, wie er ihr ausmalt. Wie der Bräutigam in Hans H. Königs ROSEN BLÜHEN AUF DEM HEIDEGRAB zeigt er seiner Verlobten stolz seine Zeichnungen von der Anordnung der Zimmer. Alle Liebenden der 50er Jahre wollten heiraten und Häuser bauen, erzählen uns die Filme. Selbst die Amateurstripperin, die bei der Misswahl in der Spelunke gewinnt, will mit dem Preisgeld ihre Einbauküche bezahlen (dem männlichen Sieger wird nur eine Kette aus Wurst umgehängt). Auch für Gina ist die bürgerlich-romantische Liebe wichtiger als Leidenschaft. Wenn Joschi mit ihr schmusen will, entzieht sie sich ihm ohne Bedauern und sagt munter, sie wolle ihm jetzt lieber was zu essen machen. Wir wollen ihr das nicht vorwerfen. Joschi tut uns zwar Leid, wenn er, betrunken und verletzt, nach Gina brüllt wie Kowalski nach Stella. Aber Frauen mussten ihre Sexualität – und so auch die der Männer – limitieren und beherrschen. Sonst wurden sie verachtet, ungewollt schwanger… oraler und analer Sex waren anscheinend keine Möglichkeit, zumindest nicht für die Leute in den Filmen.
Trotzdem, in so einer Berghütte wie der, wo die Arbeiter abends feiern, haben sie sich bestimmt gegenseitig beraten. Wie in Hans H. Königs Heimatfilm „Heiße Ernte“ herrscht eine hitzig aufgekratzte Stimmung zwischen den Männern und Frauen – kein Zweifel, sie wollen einander reizen und haben; es gibt einen Klassen-, aber keinen Geschlechterkampf. Die flüchtige Utopie einer sexuellen Einigkeit von Männern und Frauen wirkt in dieser heftchenromantischen Form sehr machtvoll und berührend. „Ist mir doch schnuppe, ich leb heute“, singen sie; groß steht die Flasche Scharlachberg Meisterbrand auf dem Kneipentisch, und Ellen Schwiers wirft ihren Schuh nach Joschi, als er flieht, weil er an seine Freundin denkt. Schwiers stand für das unberechenbar Slawische, das die Männer in der Russlandgefangenschaft so erregt haben muss.
Carl Wery hält wütend eine Predigt: Im Schützengraben und in den Bunkern habt ihr noch zu Gott geschrieen, nun wollt ihr nur noch Spaß und Sex. Aber die frechen Arbeiter beschimpfen und verprügeln die Mönche, statt sich zu besinnen, und diese wehren sich so rustikal wie Schulbengel, was alles ziemlich sexuell aussieht.
Die Mönche rekonstruieren ihr vom Kampf erschüttertes Gemüt bei sakralen Gesängen und der Planung eines Kirchenfensters mit dem fatalen Thema der Rosenlegende – wir ahnen Schlimmes. Sie haben da oben einen jungen Mann, Maurus, den sie in Paris sakrale Kunst haben studieren lassen; er ist mit Gina aufgewachsen, und, wie oft im Melodram, begegnen sich nun als Geschlechtsreife wieder und staunen über ihre Entwicklung. Besonders der arme Maurus. Er hat in Paris das Leben gesehen; nun will er mehr davon (Gina) als er darf. Verzweifelt versucht er, Modernität in das Glasfenster zu bauen. Doch der Konflikt in seinem Körper wird ihn zerschmettern wie der Steinschlag und das Dynamit.
Ein wundervoller, dicker, dicht geballter Film, der alles verstärkt und zutage treibt. Für mich toppt er wohl sogar die ihm ähnlichen TATORT… HAUPTBAHNHOF KAIRO von Youssef Chahine oder Emilie Fernandez’ VERBOTENE STRASSE (VICTIMAS DEL PECADO), die ich sehr mochte. Er reicht sogar fast an Armando Bo. Ein himmlisch-übersinnlicher, agfa-glänzender Sleaze-Juwel – und ich danke Florian Bülow für die Live-Screenshots!
An dem Abend liefen im Filmclub 813 außerdem AIDO von Susumu Hani, den fast alle Freunde mochten; hier Michael Schleehs Besprechung. Auch SOMMERSPROSSEN von Helmut Förnbacher hatten sie gern.

„Der Titel, der einen Sittenfilm erwarten lässt, täuscht: Es handelt sich um religiöse Kolportage. Vor einem Hintergrund aus Dolomitenfelsen in Agfacolor agieren abwechselnd ehrwürdige, besinnliche Bergmönche und johlende, fluchende, mit billigen Mädchen behaftete Bauarbeiter. Zwischen Gottesdienern und Gotteslästerern entbrennt ein Streit um die Wasserzufuhr, doch an der Bahre eines heroisch verunglückten Paters stehen beide Parteien gleichermaßen ergriffen“, bringt DER SPIEGEL es im Jahre 1958 auf den Punkt.
 Auf der Heimfahrt im letzten Zug nach Aachen las mir Alex Klotz zum Spaß aus einem seltsamen Roman vor, in dem lustigerweise ein Dr. Klotz vorkam, „Der Doktor Lerne“ von Maurice Renard. Er klingt ein bisschen wie „Shades of Grey“ von 1908: „Vor dem Doktor Klotz fürchtete ich mich sofort, er war so schön und so groß. Ich konnte nicht anders, ich mußte Lerne fragen, woher dieser Schwurgerichtskopf käme. – „Professor Klotz kommt aus Deutschland. Er ist sehr gescheit und ein Ehrenmann.“ (Namen sind kein Zufall. Ich bin Schimanski auch erstaunlich ähnlich.) „Wie gefall ich dir?“ fragte mich Klotz und preßte mich an sich, daß es schon keine Art mehr hatte. Ich hab dir doch vorhin erzählt, Nicolas, daß er groß und kräftig war. Seine Muskeln, fühlte ich, waren aus Eisen und ich gab mich drein, ohne daß ich es wollte: „Los, Emma, los! Haben wir uns heute! Denn… du wirst mich nicht wiedersehen!“ Ich bin nicht feige. Ich ward, unter uns gesagt, schon von Händen zärtlich umgefaßt, die Mörderhände waren. Meine ersten Liebhaber taten in ihrer Liebe so zu mir, als ob sie mich mit Faustschlägen traktierten … so schwer und so hart; man ist ihnen einfach Opfer; man weiß nicht, spürt man Schmerz oder Vergnügen. Was übrigens gar nicht so unangenehm ist. Aber all das war nichts gegen dies. Die Nacht mit Klotz war furchtbar. Wie eine Notzüchtigung. Ich hab heut noch den Schrecken und die Mattigkeit davon im Leibe. Spät am Vormittag erwachte ich. Er lag nimmer neben mir. Ich hab ihn nie wiedergesehen.“ (Foto „Klotzilla“: Stefan Keller)
Auf der Heimfahrt im letzten Zug nach Aachen las mir Alex Klotz zum Spaß aus einem seltsamen Roman vor, in dem lustigerweise ein Dr. Klotz vorkam, „Der Doktor Lerne“ von Maurice Renard. Er klingt ein bisschen wie „Shades of Grey“ von 1908: „Vor dem Doktor Klotz fürchtete ich mich sofort, er war so schön und so groß. Ich konnte nicht anders, ich mußte Lerne fragen, woher dieser Schwurgerichtskopf käme. – „Professor Klotz kommt aus Deutschland. Er ist sehr gescheit und ein Ehrenmann.“ (Namen sind kein Zufall. Ich bin Schimanski auch erstaunlich ähnlich.) „Wie gefall ich dir?“ fragte mich Klotz und preßte mich an sich, daß es schon keine Art mehr hatte. Ich hab dir doch vorhin erzählt, Nicolas, daß er groß und kräftig war. Seine Muskeln, fühlte ich, waren aus Eisen und ich gab mich drein, ohne daß ich es wollte: „Los, Emma, los! Haben wir uns heute! Denn… du wirst mich nicht wiedersehen!“ Ich bin nicht feige. Ich ward, unter uns gesagt, schon von Händen zärtlich umgefaßt, die Mörderhände waren. Meine ersten Liebhaber taten in ihrer Liebe so zu mir, als ob sie mich mit Faustschlägen traktierten … so schwer und so hart; man ist ihnen einfach Opfer; man weiß nicht, spürt man Schmerz oder Vergnügen. Was übrigens gar nicht so unangenehm ist. Aber all das war nichts gegen dies. Die Nacht mit Klotz war furchtbar. Wie eine Notzüchtigung. Ich hab heut noch den Schrecken und die Mattigkeit davon im Leibe. Spät am Vormittag erwachte ich. Er lag nimmer neben mir. Ich hab ihn nie wiedergesehen.“ (Foto „Klotzilla“: Stefan Keller)



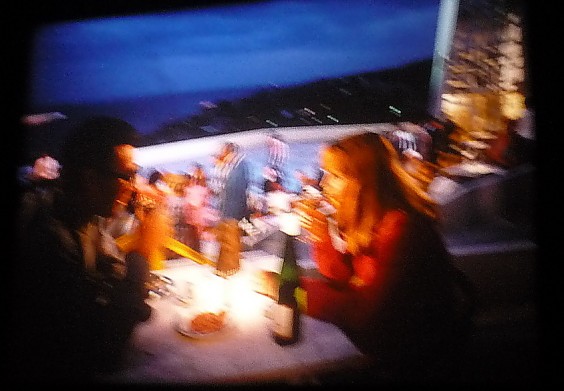





































2 Kommentare zu "Filmtagebuch einer 13-Jährigen #7"
Hi there,
Fantastic blog. I know it’s an old post, but just wondering where you managed to get view a copy of Vergewaltigt? I cannot track it down anywhere.
Trackbacks für diesen Artikel